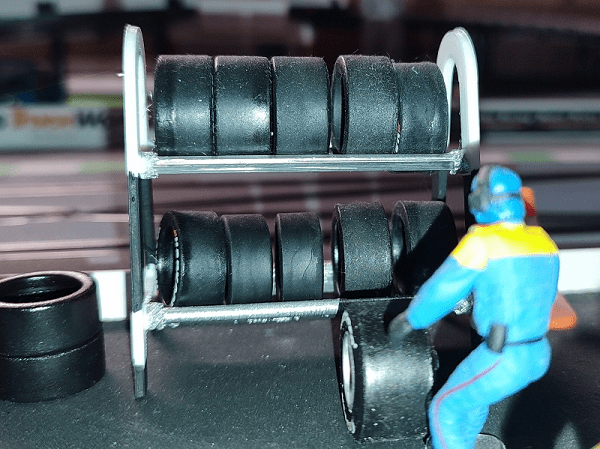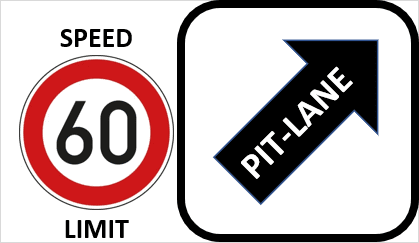Heftig, heftiger, am heftigsten – oder die Crux mit dem Haftverstärker!
Wie einige vielleicht wissen, zumindest wenn mehr als nur der Terminplaner angeschaut wird, bastle ich nebenbei an meinem Langzeitprojekt „Prüfstand“. Mittlerweile ist dieser aus der Alpha-Phase raus und liefert auch schon brauchbare Daten. Naja, eigentlich macht er dies schon etwas länger, aber in dieser Woche habe ich mal meine kompletten 1:24er Carrera-Fahrzeuge aus meinem Slotkoffer über den Prüfstand geschickt. Und warum ist mir dies einen Beitrag wert? Ganz einfach, er zeigt auf, wie unterschiedlich einige wichtige Faktoren sind und wie weit Einige davon auseinanderliegen. Zum anderen habe ich auch nicht permanent Lust darauf nur Rennberichte zu schreiben.
Alles ist gleich, aber manches ist gleicher!
Ein schöner Satz, der falscher nicht sein kann, zumindest wenn es um Slotcars geht! Nichts ist gleich und gleicher schon mal gar nicht. Nicht ohne Grund haben wir bisher ein gemischtes Feld in einem Cup vermieden. Dadurch sind bis jetzt immer die Faktoren wie Radstand, Spurbreite und Gewicht aus dem Gesamtpaket herausgefallen. Bei identischen oder ähnlichen Fahrzeugen waren die Unterschiede sehr gering bis nicht vorhanden. Als gutes Beispiel kann der BToM-Cup dienen. Dort fuhr ein Fahrzeug mit, welches wesentlich andere Dimensionen aufwies als die restliche Fahrzeugflotte und hatte dadurch meist das Nachsehen. Der BMW M4 ist halt breiter, länger und schwerer als ein reguläres DTM-Fahrzeug.
Aber dies sind Punkte, auf die jeder Fahrer einen direkten Einfluss hat. Jeder könnte bei einem gemischten Feld selbst entscheiden mit welchem Fahrzeug er antreten möchte. Welche Konstellation würde einem besser liegen? Fährt man eher gerne hecklastig oder mag man es ausgewogen? Bei vielen Klassen hat man durch die große Auswahl die Qual der Wahl oder halt die Freiheit nach seinen Vorlieben zu wählen.
Wo bleibt die Crux?
Es gibt jedoch drei Baugruppen, auf die man keinen Einfluss hat oder zumindest nicht direkt. Zum einen wäre dies der Decoder, hinzu kommt der Motor und schlussendlich die verbauten Magnete. Im Großen und Ganzen könnte man den Decoder allerdings vernachlässigen aber es gab zuletzt einige Änderungen an diesem Konstrukt. Das Leistungsbauteil wurde gegen den eines anderen Herstellers getauscht und das IC wurde zuletzt ebenfalls geändert. Dem neuen Leistungsbauteil wurde ein erhöhter Stromfluss nachgesagt, ob dies stimmt kann ich allerdings nicht beurteilen, denn ich habe bewusst noch keinen Decoder mit diesem neuen Bauelement gefahren. Immerhin unterliegen solche Standardbauelemente auch standardisierten Spezifikationen, sollten sie zumindest. Das neue IC hat allerdings andere Eigenschaften. Es ist kleiner und segnet schneller das Zeitliche, zumindest unter erhöhter Belastung. Dies ist eher nachteilig für den Fahrer bzw. für das Einsatzfahrzeug und dem eigenen Portemonnaie.
Kommen wir zum Herzstück von jedem Fahrzeug, dem Motor. Immerhin ist er dafür verantwortlich, dass sich das Fahrzeug bewegt und so seine Funktion erfüllen kann. Eins vorweg, es handelt sich in unserem Fall um Spielzeug! Dies bedeutet, die Streuung kann unter Umständen sehr groß sein – auch nach unten. Man kann aber die Leistung eines Motors sehen und messen und ganz wichtig, eventuell durch richtiges einstellen steigern. Allerdings ist man bei ungünstigen Toleranzbewegungen (z.B, Welle an der oberen Toleranz und Lager an der unteren) machtlos. Wenn der Motor beim Fahren kreischt, dann sollte man das Spiel zwischen Achsritzel und Motorritzel einstellen. Im ungünstigsten Fall wird die Motorwelle an die Lagerbuchse gedrückt und läuft mit der Zeit ein – dies verändert dann auch den Abstand zwischen Wicklung und Magnet. Dazu kommen dann noch thermische Auswirkungen, denn der Motor zieht dann ebenfalls mehr Strom, was dann den Decoder mehr belastet und diesen eventuell auch schneller über die Klinge springen lässt. Bestes Beispiel für thermische Belastung, gibt es auch in unseren Reihen, der Wagen fährt anfangs gut und schnell und lässt im Laufe des Rennens nach. Die verschiedenen Werkstoffe im Motor verhalten sich bei steigender Motortemperatur anders und es kommt zu diversen Toleranzverschiebungen! Ein weiterer Punkt wäre die Schmierung. Die Lagerbuchsen sind gefettet (hoffentlich), weil Fett in der Regel auch dort bleibt wo es aufgetragen wurde. Kommt jetzt noch Öl dazu, unwissend gut gemeint, kann sich die chemische Zusammensetzung der beiden Komponenten verändern – z. B. Klumpenbildung beim Fett.
Die liegt hier vergraben
Last but not least, der zusätzliche Haftverstärker. Ja, mittlerweile können wir den Effekt auf dem Prüfstnd ebenfalls messen und dieser zeigt auch gnadenlos die Größe der Differenz auf. Bei meinen 11 Fahrzeugen waren das über 1000 Gramm (428 zu 1463), wobei man dies relativieren muss, denn der Prüfstand hat eine Stahlplatte und die Leiter der Carreraschiene bestehen aus Edelstahl mit einem mir unbekannten Eisenanteil. Das heißt also, die Werte sind nicht 1:1 übertragbar. Trotz allem wäre der Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen logischer Weise auf der Schiene identisch, prozentual gesehen. Jetzt könnte die Meinung aufkommen, mehr ist besser! Nein, denn jetzt kommt die Crux an dem Ganzen. Am Anfang mögen die Magneten hilfreich sein, besser mit der Materie Slotcar zurecht zu kommen und nicht gleich frustriert alles hinzuwerfen. Wobei viele auch gleich zu Beginn ohne fahren, aber halt insgesamt langsamer. Viele Hersteller verbauen auch schon keine Haftverstärker mehr oder wenn nur ganz schwache. Bei denen dient es dann eher als zusätzliches Gewicht um den Schwerpunkt weiter nach unten zu bekommen. Carrera verbaut die Dinger, weil sie damit die Schwachstellen der Produktion ausgleichen wollen, inkl. der mangelhaften Reifenqualität. Dadurch wird unter anderem der negative Effekt der nicht zentrischen Bohrungen an den Felgen „kaschiert“. Das Fahrzeug liegt dadurch ruhiger obwohl es eigentlich hoppelt wie ein Hase aber die Reifen werden durch die Schwerkraft sowie der zusätzlichen Magnetkraft auf die Schienen gezogen. Mag sich gut anhören, ist es aber nicht. Es belastet zusätzlich negativ den Decoder und den Motor, welche normalerweise mit den restlichen physikalischen Gesetzen wie Beschleunigung, Rollwiderstand und Fahrzeuggewicht (u.a. Masse/Trägheit, Erdanziehung) genug zu leisten haben. Ausserdem bildet die Magnetkraft keine feste Konstante, was das Fahren in Kurven erschweren kann. Der Grip bleibt nahezu berechenbar, egal wo sich die Reifen auf der Schiene befinden und einen zu starken Drift kann man mit Lupfen des Gashebels korrigieren. Bei der Magnethaftung sieht es anders aus. Bei „normaler“ Fahrt ist sie da und hilft aktiv, kommt das Fahrzeug aber in einen Drift verringert sich die Anziehungskraft enorm oder reißt sogar ab. Am Ende fegt es das Fahrzeug plötzlich und unverhofft von der Strecke, ohne die Chance etwas zu korrigieren. Bestes Beispiel dafür wäre der BTM-Cup im Vergleich zum BToM-Cup. Schaut man sich die letzten Rennen an, so sieht man mit Magnet gab es mehr Abflüge als Ohne, als sich alle daran gewöhnt hatten. Den Effekt gab es bei uns auch bei einem gemischten Feld in 1:32, mit und ohne Magnet. Es wird sich auf den Haftverstärker verlassen, obwohl man sich auf diesen nicht verlassen kann! Frei nach dem Motto „heftig, heftiger am heftigsten – wie der Magnet so auch der Abflug“.
Einzelne relevante Messdaten
In der Tabelle sind ein paar Messdaten meines 1:24er Fuhrparks aufgelistet, wobei ich bewusst auf die Modellbezeichnungen verzichtet habe. Bis auf die letzten Beiden sind der Rest alles moderne GT-Fahrzeuge. Die benannten Zwei am Ende gehören zur Kategorie „Classic“. Das der nette Kollege mit einer Downforce von 1463 Gramm ein Ford GT Race Car ist, kann ich ruhig verraten – der Magneteffekt ist bei diesem Fahrzeugtyp hinlänglich bekannt. Dabei kommt der verbaute Magnet ursprünglich aus Fzg. 2 und hatte vor dem Umbau knappe 750 Gramm. Es handelte sich dabei um einen Ringtausch. Alle anderen Fahrzeuge sind quasi „OotB“, zumindest was das Innenleben betrifft. Achsen hat der eine oder andere schon mehrfach neu bekommen, gehört damit aber eher in die Kategorie „Optimierung“ und hat außer auf das Fahrverhalten keinen Einfluß.
| Fahrzeug | RPS | RPM | MPS | D-Force | Mot. (°C) | V | mA | mW |
| Fzg. 1 | 62,33 | 3740 | 4,41 | 986 | 23,29 | 17,98 | 525,9 | 9188 |
| Fzg. 2 | 67,33 | 4040 | 4,76 | 1227 | 23,05 | 18,0 | 620,1 | 10780 |
| Fzg. 3 | 62,0 | 3720 | 4,38 | 1463 | 23,97 | 17,98 | 719,2 | 12432 |
| Fzg. 4** | 72,67 | 4360 | 5,14 | 713 | 30,67 | 17,98 | 625,1 | 10888 |
| Fzg. 5** | 58,67 | 3520 | 4,15 | 1137 | 31,81 | 18,05 | 1145,1 | 18376 |
| Fzg. 6 | 70,33 | 4220 | 4,97 | 1299 | 23,21 | 18,0 | 655,3 | 11302 |
| Fzg. 7 | 71,33 | 4280 | 5,04 | 707 | 22,53 | 17,99 | 492,8 | 8622 |
| Fzg. 8 | 66,0 | 3960 | 4,67 | 915 | 22,19 | 17,99 | 610,5 | 10654 |
| Fzg. 9** | 69,33 | 4160 | 4,90 | 972 | 32,35 | 18,0 | 1387,7 | 22990 |
| Fzg. 10** | 69,67 | 4180 | 4,92 | 544 | 34,25 | 17,99 | 512,7 | 8976 |
| Fzg. 11** | 70,0 | 4200 | 4,95 | 428 | 27,23 | 17,98 | 437,8 | 7704 |
**Fahrstufentest vorgezogen, deswegen erhöhte Motortemperatur
Vergleich der Fahrstufen von 1 bis 10
Auch wenn es nicht so relevant ist, die untere Tabelle zeigt noch die Umdrehungen pro Sekunde auf den einzelnen Fahrstufen an. Geprüft wurden die einzelnen Stufen über eine Dauer von 10 Sekunden. Natürlich im Leerlauf, denn der Motor musste weder die Fahrzeugmasse bewegen, noch gegen die Anziehungskraft arbeiten. Deswegen sind in den höheren Stufen die Werte dicht zusammen. Bei Belastung des Motors wären die Unterschiede etwas größer.
Beim Fahrzeug 4 gab es Probleme mit der Strombegrenzung des Sensors, weshalb keine Messwerte aufgenommen wurden bzw. der Versuch nach einigen Durchgängen abgebrochen wurde. Sobald ich den Stromsensor ausgetauscht habe, kann ich diese Werte nachliefern.
| Fahrzeug | FS1 | FS2 | FS3 | FS4 | FS5 | FS6 | FS7 | FS8 | FS9 | FS10 |
| Fzg. 1 | 26 | 30 | 33 | 40 | 44 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 |
| Fzg. 2 | 19 | 23 | 27 | 35 | 39 | 43 | 51 | 59 | 67 | 68 |
| Fzg. 3 | 26 | 29 | 33 | 40 | 43 | 46 | 52 | 58 | 59 | 62 |
| Fzg. 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fzg. 5 | 40 | 44 | 47 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Fzg. 6 | 29 | 33 | 37 | 46 | 50 | 55 | 62 | 71 | 72 | 73 |
| Fzg. 7 | 28 | 32 | 36 | 45 | 49 | 53 | 61 | 70 | 72 | 73 |
| Fzg. 8 | 27 | 31 | 35 | 43 | 47 | 51 | 58 | 66 | 67 | 68 |
| Fzg. 9 | 28 | 30 | 34 | 43 | 47 | 53 | 60 | 68 | 69 | 70 |
| Fzg. 10 | 30 | 34 | 37 | 46 | 50 | 55 | 63 | 69 | 71 | 72 |
| Fzg. 11 | 30 | 34 | 38 | 45 | 49 | 53 | 60 | 67 | 69 | 70 |
Epilog
Wie so oft ist es mal wieder ein wenig mehr Text geworden als gewollt, aber wer den Epilog noch liest hat Durchhaltevermögen und meinen Dank, dass die kostbaren Minuten für diese Zeilen nicht umsonst waren. Alles hier geschriebene basiert nicht auf irgendwelche Studien oder Forschungen, sondern lediglich auf meinen beschränkten Sachverstand für Technik und meiner Erfahrungen und Beobachtungen. Sollte ich etwas falsch interpretiert oder wiedergegeben haben, dann lasst es mich gerne wissen und eventuell korrigiere ich es dann auch. Ist halt ein Zeitfaktor. Aber auch die Fehler anderer, in diesem Fall meine, können einen selbst zum Lernen und Nachforschen anregen, z.B. wenn man es genauer und besser wissen will als der „unwissende“ Schreiberling.